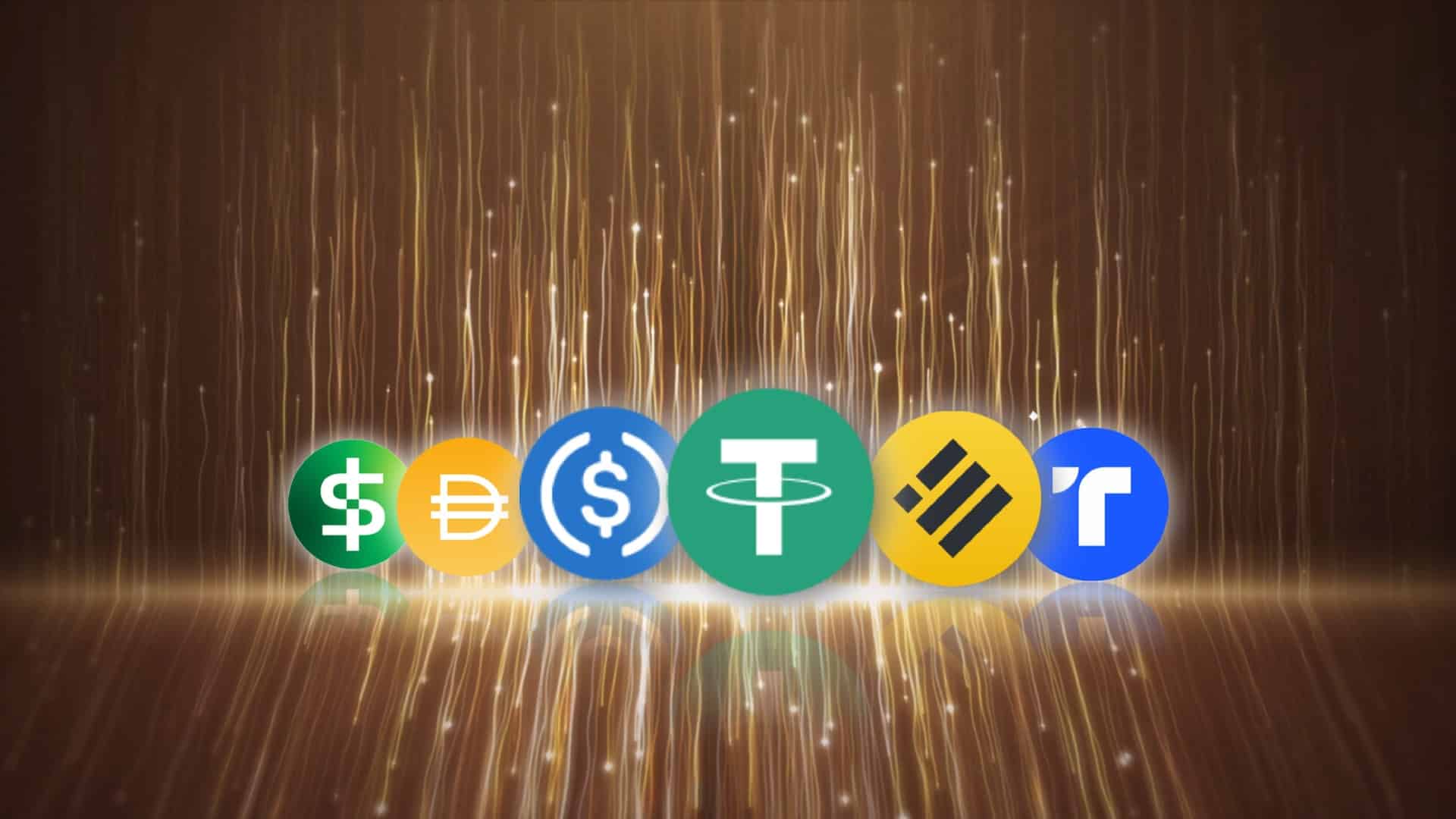- Die Bank of England prüft zeitlich befristete Limits für Bestände und Transaktionen systemischer Stablecoins, um Bankeinlagen und Unternehmensfinanzierung zu schützen.
- Vorgeschlagen sind Obergrenzen von £20.000 für Privatpersonen und £10 Millionen für Unternehmen, mit dynamischer Kalibrierung und Exit-Kriterien bei sinkendem Risiko.
Die Bank of England erwägt vorübergehende Obergrenzen für Bestände und Transaktionen ausgewählter, systemrelevanter Stablecoins. Ziel ist es, abrupte Abflüsse von Bankeinlagen und plötzliche Umschichtungen in der Geldmarktfinanzierung zu verhindern. Gleichzeitig werden Aufsicht und Marktinfrastruktur für eine breite Nutzung von Stablecoins ausgebaut. Laut Bloomberg liegen die Richtwerte bei 20.000 Pfund pro Person und 10 Millionen Pfund pro Unternehmen. Die Obergrenzen sollen regelbasiert angepasst und aufgehoben werden, sobald Kennzahlen zur Einlagendynamik, zu Zahlungen und zur Geldmarktbelastung Entwarnung geben.
Wie die BoE Caps kalibrieren und wieder abbauen will
Die vorgeschlagene Architektur kombiniert Volumenobergrenzen mit Monitoring-Fenstern. In Phasen erhöhter Sensitivität – etwa bei steigenden Geldmarktsätzen, sinkender Einlagenbasis ausgewählter Institute oder Störungen im Zahlungsverkehr – greifen Caps als temporärer Puffer.
Die Kalibrierung orientiert sich an Indikatoren wie Nettomittelzuflüssen in Stablecoins, LCR- und NSFR-Quoten großer Banken, Swap-Spreads sowie Settlement-Verzögerungen im Retail- und Wholesale-Zahlungsverkehr. Ein definiertes Set an Exit-Schwellen soll sicherstellen, dass die Limits nicht länger als nötig bestehen bleiben.
Für Emittenten heißt das, ihre Ausgabe- und Einlöseprozesse an potenzielle Cap-Mechanismen zu koppeln; für Wallets und Handelsplätze braucht es harte Prüfungen pro Konto, KYC-gestützte Zuordnung von Nutzerkategorien und transparente Fehlermeldungen bei Cap-Verstößen.
Operativ dürften Emittenten verpflichtet werden, tägliche Reservenachweise, Einlösefenster, Cut-off-Zeiten und Backstop-Liquidität offen zu legen. Verwahrer und Zahlungsdienstleister müssen Konten in Personen- und Unternehmenskategorien trennen, Limits durchsetzen und Ereignisprotokolle für Aufsichtsprüfungen führen. Für grenzüberschreitende Flüsse sind Koordinationsabkommen mit anderen Zentralbanken und Aufsichten notwendig, damit Caps nicht via Offshore-Routing umgangen werden.
Konsequenzen für Stablecoin-Emittenten und DeFi-Anbindungen
Für Emittenten systemischer Stablecoins rücken drei Handlungsfelder in den Vordergrund. Erstens Reservemanagement: Kürzere Duration, höhere Kasseanteile und vertraglich gesicherte Kreditlinien reduzieren Einlösefriktionen. Zweitens Transparenz: häufigere Attestierungen, granularere Offenlegung der Sicherheiten und klare Stress-Test-Ergebnisse stärken das Vertrauen in Einlösemechanismen. Drittens technische Durchsetzung: Wallet- und API-Schnittstellen müssen Caps deterministisch prüfen und Fehlversuche in Echtzeit zurückliefern, ohne legitime Zahlungen zu blockieren.
DeFi-Protokolle, die Stablecoins als Collateral akzeptieren, müssen Cap-Logik in Risikomodule spiegeln. Niedrigere Beleihungswerte für systemische Token während Cap-Phasen, adaptive Liquidationsschwellen und Failover-Routinen bei verzögerten Einlösungen sind naheliegende Anpassungen. Börsen und Broker sollten Preisdaten auf atypische Basis-Spreads zwischen Stablecoin-Peg, Bids/Asks und Geldmarktsätzen überwachen, um kurzfristige Belastungen der Peg-Stabilität früh sichtbar zu machen.
Für Unternehmen ergeben sich taktische Optionen. Treasury-Abteilungen können Zahlungsströme auf mehrere Emittenten verteilen, um Cap-Risiken zu glätten, und zugleich Revolving-Credit-Fazilitäten als Puffer vorhalten. Institutionelle Anleger dürften prüfen, ob Repo- und Geldmarktprodukte im Cap-Regime verlässlich als Zwischenparkplätze fungieren. Privatanleger sollten wissen, dass Caps nicht als Strafmaßnahme gedacht sind, sondern als vorübergehende Leitplanke, die mit klaren Exit-Signalen wieder fällt.