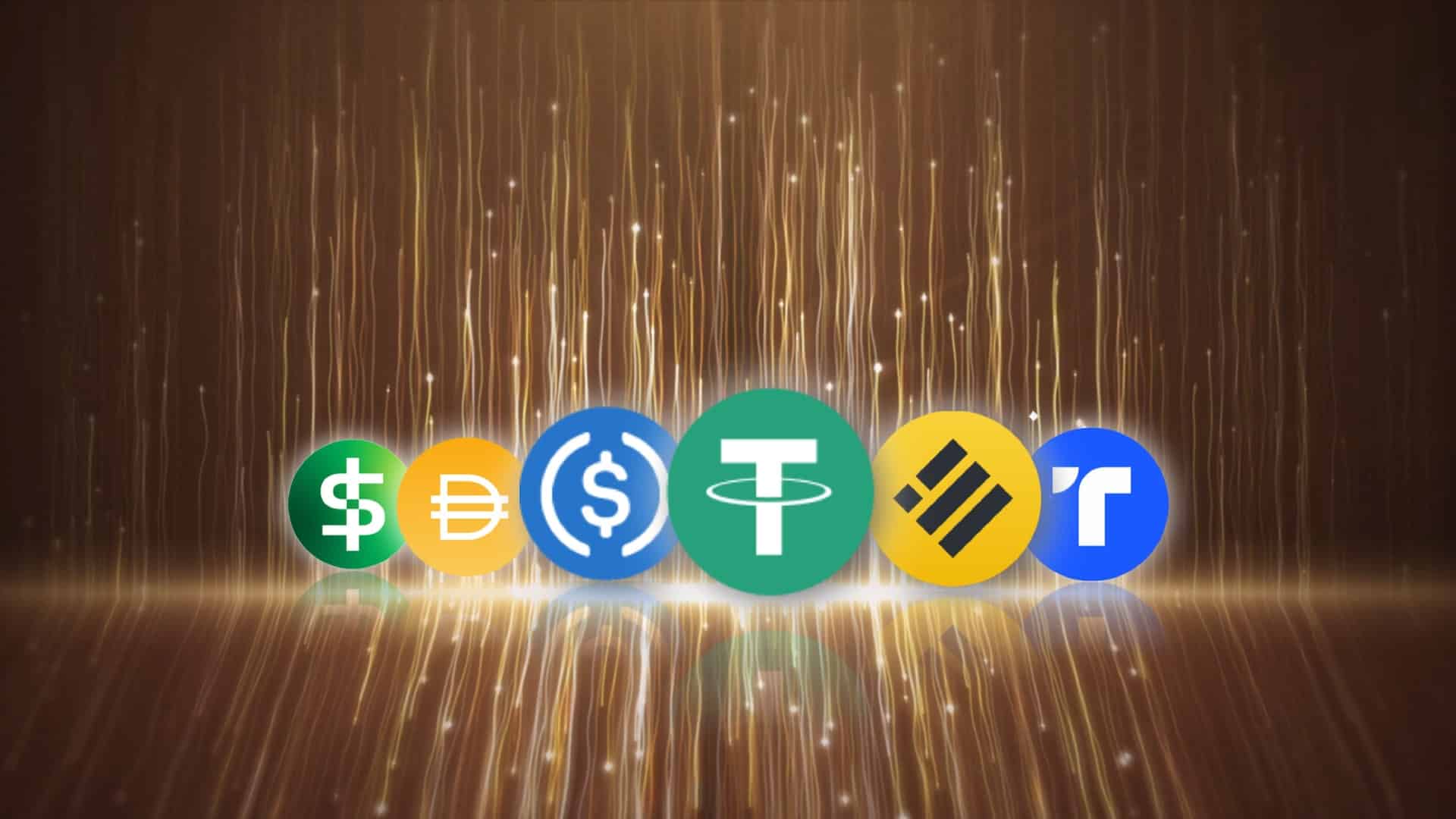- Olaf Sleijpen warnt, dass stark wachsende Stablecoins systemrelevant werden und bei Stress schnelle Assetverkäufe auslösen könnten.
- Die EZB müsste bei starken Schocks die Geldpolitik überdenken, wobei offen ist, ob dies zu Zinserhöhungen oder Zinssenkungen führen würde.
Die Europäische Zentralbank könnte Stablecoins künftig nicht nur als Aufsichtsthema, sondern auch als makroökonomischen Risikofaktor betrachten. Darauf weist Olaf Sleijpen, Direktor der Niederländischen Zentralbank, hin.
Demnach haben vor allem Dollar-gebundene Token eine Größenordnung erreicht, die sie potenziell systemrelevant für das europäische Finanzökosystem macht.
Entscheidend sind neben der Marktkapitalisierung die zunehmende Nutzung als Abwicklungs- und Collateral-Instrument in Krypto- und tokenisierten Märkten sowie die wachsende Verflechtung mit regulierten Finanzakteuren.
Sleijpen betont das Kernrisiko prozyklischer Liquidationen. Sollten Stablecoins unter Druck geraten, müssten Reserveportfolios rasch veräußert werden. Diese Portfolios bestehen typischerweise aus kurzlaufenden Staatsanleihen, Geldmarktinstrumenten und Einlagen.
In Stressphasen kann gebündelter Verkaufsdruck die Marktliquidität belasten, Geldmarktsätze verschieben und Spannungen in der Sicherheitenkette erzeugen.
In einer europäischen Perspektive käme hinzu, dass Dollar-Dominanz in Stablecoins Wechselkurskanäle verstärken und inländische Finanzierungsbedingungen indirekt beeinflussen kann.
Für die Finanzstabilität nennt er drei Beobachtungspunkte. Erstens die Transparenz und Frequenz der Reserveberichte, inklusive Laufzeiten, Emittenten und Liquiditätsprofil.
Zweitens die Governance der Emittenten, etwa Zugriff auf Kreditlinien, Stresstestregime und Regeln für Rücknahmen.
Drittens die Interaktion mit Marktplattformen und Verwahrstellen, die im Fall von Redemption-Wellen operative Engpässe auslösen könnten.
Implikationen für Inflationsdynamik und EZB-Werkzeugkasten
Makroökonomisch könnten großvolumige Umschichtungen aus Stablecoins in Bankeinlagen oder umgekehrt die Transmission geldpolitischer Impulse modulieren. Starke Rückgaben würden Liquidität aus Geldmärkten saugen und kurzfristige Zinsen vorübergehend anheben.
Umgekehrt könnten Zuflüsse in Stablecoins Bankeinlagen verringern und Kreditkanäle belasten. In Extremszenarien wären Zweitrundeneffekte auf Kreditkosten, Nachfrage und damit auf die Preisentwicklung denkbar.
Sleijpen hält es daher für möglich, dass die EZB ihre geldpolitische Reaktionsfunktion anpassen muss, falls die Schockwellen kräftig genug ausfallen. Ob dies Netto-Straffung oder Lockerung erfordert, hänge vom Richtungssignal der Schocks ab.
Regulatorisch bleibt MiCAR der zentrale Rahmen in der EU. Für die Risikoperspektive entscheidend sind harte Liquiditätsanforderungen, klare Regeln für Reservezusammensetzung und tägliche Rückgaben, Stresstest-Pflichten, Notfallliquidität sowie einheitliche Offenlegungen.
Aufsichtsbehörden könnten ergänzend Obergrenzen für Konzentrationsrisiken, engere Vorgaben zur Duration und Limits für nicht staatliche Emittenten im Reservepool erwägen. Für Infrastrukturen, die Stablecoins als Collateral akzeptieren, sind Haircuts, Intraday-Margins und Fallback-Mechanismen zu überprüfen.
Für Banken und Kapitalmarktteilnehmer rücken operative Hausaufgaben in den Fokus. Treasury-Teams benötigen Szenarien für plötzliche Spread-Ausweitungen im Geldmarkt, Alternativ-Refinanzierungen und die Behandlung von Stablecoin-Exposures in Liquiditätskennzahlen.
Börsen und Verwahrer müssen Abwicklungswege, Gatekeeping-Prozesse und Transparenz über Token-Rückgaben robust gestalten. Asset Manager sollten die Korrelation zwischen Stablecoin-Stress und Portfoliorisiken explizit modellieren und gegebenenfalls Limitrahmen anpassen.
Die Debatte verlagert Stablecoins damit schrittweise aus der Nische in den Kern des makroprudenziellen Monitorings. Ob und wie stark die EZB reagieren müsste, hängt am Ende von der Tiefe der Verflechtungen, der Qualität der Reservesicherungen und der Geschwindigkeit, mit der Schocks durch europäische Geld- und Kapitalmärkte laufen.