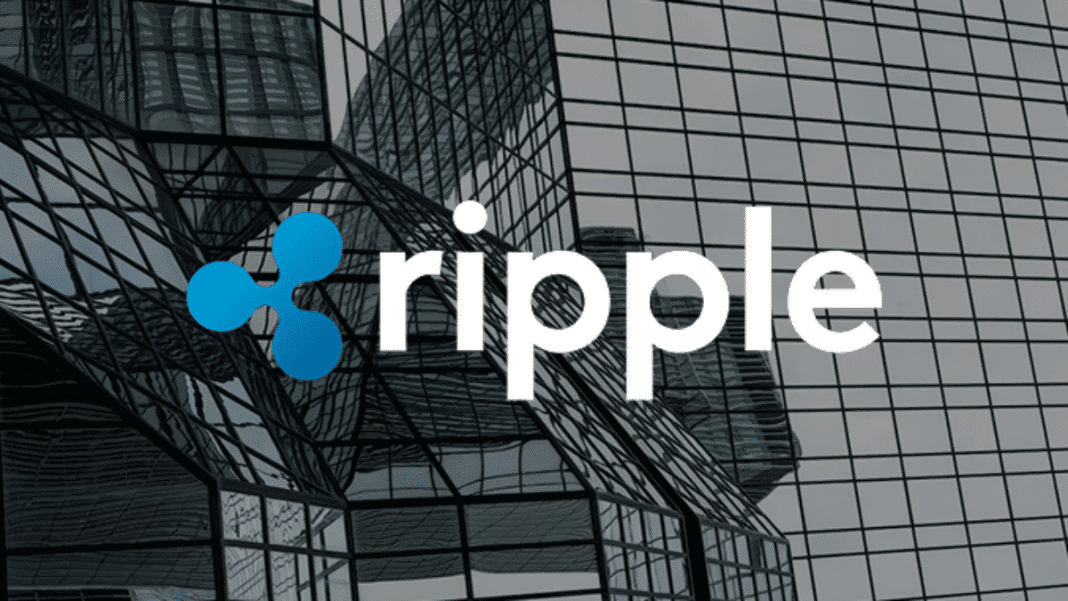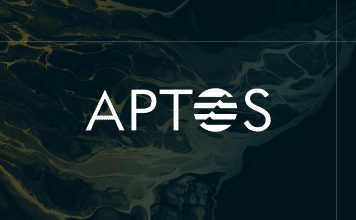- RippleX-Engineeringchef J. Ayo Akinyele stellt die Frage, ob Staking die Utility von XRP erweitern und Validator- sowie Tokenhalter-Anreize besser ausrichten kann.
- CTO David Schwartz skizziert zwei Staking-nahe Ansätze, betont aber: „Beide sind technisch großartig, aber wahrscheinlich nicht realistisch gut, zumindest nicht in absehbarer Zeit.“
Im Ripple-Umfeld mehren sich öffentliche Überlegungen, den 2012 gestarteten XRP Ledger (XRPL) um Staking-Funktionen zu ergänzen. Ziel der Befürworter ist es, die Anreizstruktur zwischen Validatoren und Tokenhaltern stärker zu koppeln und damit langfristige Teilnahme, Sicherheit und DeFi-Nutzungen zu fördern.
„Wenn ich darüber nachdenke, wie sich die Utility von XRP parallel zu neuen Fähigkeiten weiterentwickeln kann, drängt sich die Frage nach Staking natürlich auf“,
schreibt RippleX-Engineeringchef J. Ayo Akinyele. Staking fördere
„langfristige Teilnahme und kann die Sicherheit stärken, indem diejenigen belohnt werden, die beim Konsens helfen“.
Im Status quo verbrennt der XRPL Transaktionsgebühren, um Spam zu begrenzen und die Effizienz zu erhalten. Ein natives Staking-Modell würde eine neue Quelle und faire Verteilung von Rewards erfordern – eine Änderung, die in die Kernlogik des Protokolls eingreift.
Zugleich steht das Designprinzip „Proof of Association“ im Raum, das Stabilität und Vertrauen über rein finanzielle Anreize stellt.
Entsprechend stellt sich die Frage, ob Staking mit der ursprünglichen Ausrichtung auf hochperformante, grenzüberschreitende Zahlungen vereinbar ist und wie sich eine Umstellung auf Governance, Emission und Wirtschaftslogik von XRP auswirkt.
Zwei Skizzen des CTO – und ein Warnhinweis
Ripple-CTO David (JoelKatz) Schwartz ordnet die Diskussion in die technologische Entwicklung der Branche ein:
„XRP Ledger wurde 2012 geschaffen. Die Blockchain-Welt hat sich seitdem viele, viele Male verändert.“
Er verweist auf wachsende DeFi-Nutzung – nativ und via Ökosysteme wie Flare, MoreMarkets, Axelar oder Doppler – sowie laufende Programmierbarkeits- und Smart-Contract-Diskussionen. Vor diesem Hintergrund nennt er zwei Ideen.
Eine Idee wäre, auf ein zweilagiges Konsensmodell zu wechseln, bei dem die innere Schicht incentiviert ist. Die innere Schicht hätte 16 Validatoren, die von der äußeren Schicht auf Basis von Stake gewählt werden, und würde Staking/Slashing nur nutzen, um das Ledger fortzuschreiben. Damit entstünde ein begrenzter, ökonomisch motivierter „Kern“, während das äußere Set die heutige Assoziationslogik wahrt.
Die andere Idee ist, den Konsens unverändert zu lassen, aber Transaktionsgebühren zu nutzen, um ZK-Beweise korrekter Smart-Contract-Ausführung zu bezahlen, damit Nodes die Smart Contracts nicht selbst ausführen müssen.
Das würde Rechenlast auslagern und Skalierung/Programmierung vorantreiben, ohne Konsensregeln zu überarbeiten.
Gleichzeitig bremst Schwartz Erwartungen:
„Beide sind technisch großartig, aber wahrscheinlich nicht realistisch gut, zumindest nicht in absehbarer Zeit.“
Der CTO deutet damit an, dass Nutzen-Risiko-Abwägungen, Migrationspfade und Kompatibilität mit bestehenden Validierungs- und Governance-Prozessen entscheidend sind, bevor ein formaler Vorschlag reif ist.
Für eine mögliche Roadmap wären mehrere Punkte zu klären: Belohnungsquelle, etwa durch Umwidmung eines Teils der Gebühren statt vollständigem Burn, Verteilungslogik über Zeit und Validator-Sets, Slashing-Regeln und Haftungsrahmen, ökonomische Nebenwirkungen auf Liquidität und Preisbildung von XRP sowie Rückfallebenen für den Fall von Designfehlern.
Ebenso zentral ist die Interoperabilität mit geplanten Smart-Contract-Funktionen, damit Staking nicht isoliert, sondern als Teil eines konsistenten DeFi-Stacks entsteht.
Aus Investorensicht wäre zu erwarten, dass eine Staking-Ökonomie die Halteanreize für XRP verändert, während die Netzwerksicherheit stärker ökonomisch unterlegt würde. Dem stehen Risiken gegenüber: potenzielle Zentralisierung in einem inneren Validator-Ring, neue Angriffsflächen durch Slashing-Ökonomie und Governance-Komplexität.
Vorerst bleibt es bei der offenen Konzeptdiskussion.
„Es schien ein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen, wie native DeFi-Fähigkeiten aussehen könnten“,
sagt Schwartz – mit dem impliziten Hinweis, dass Architektur-Eingriffe am XRPL evolutionär erfolgen müssten.