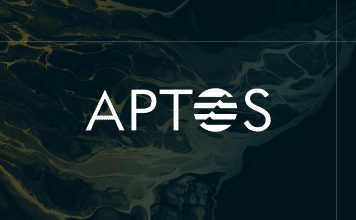- Die AfD beantragt eine strategische Bitcoin-Reserve nach dem Vorbild staatlicher Goldbestände und begründet dies mit Inflationsschutz und Diversifikation.
- Zur Prüfung stehen Mandat und Rechtsrahmen, Verwahr- und Bewertungsstandards, Best-Execution-Vorgaben für Zukäufe sowie die Einbettung in EU- und EZB-Regime.
Die Diskussion um digitale Staatsreserven erreicht Deutschland. Die AfD, zweitgrößte Oppositionsfraktion im Bundestag, hat die Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve beantragt. Der Vorstoß argumentiert mit Währungs- und Inflationsrisiken sowie der Knappheitseigenschaft von Bitcoin als möglichem Diversifikationsbaustein neben Gold. Politisch ist der Ausgang offen, fachlich setzt der Antrag eine Reihe von Prüfaufträgen in Gang.
Antragskern und parlamentarischer Fahrplan
Inhaltlich schlägt der Antrag eine regelgebundene Reservepolitik vor, die Erwerb, Halten und Berichten von Bitcoin-Beständen definiert. Operativ kämen zwei Träger in Betracht: die Deutsche Bundesbank im Rahmen der Währungsreserven oder ein zweckgebundenes Sondervermögen des Bundes. Der parlamentarische Prozess führt über federführende Ausschüsse (Finanzen, Haushalt, Recht, Digitales), Anhörungen und eine Beschlussempfehlung.
Für die Regierungs- und Behördenpraxis ergeben sich fünf Prüfblöcke:
- Rechtsgrundlage und Mandat: Erfordernis einer ausdrücklichen Ermächtigung im Bundesbankgesetz bzw. haushaltsrechtliche Regeln für Erwerb, Bewertung und Veräußerung digitaler Vermögenswerte.
- Strategie und Governance: Zielbandbreite, Rebalancing-Logik, Notfallmechanismen, Reporting-Zyklen und Prüfrechte (Bundesrechnungshof, parlamentarische Gremien).
- Beschaffungspfad: Best-Execution-Kriterien (OTC-Routen, Referenzpreise, Ausreißerfilter), Zeitstaffelung zur Minimierung von Marktimpact sowie Umgang mit etwaigen Verwertungserlösen aus Sicherstellungen.
- Transparenz und Bewertung: Offenlegung von Beständen, Bewertungsmethoden (Mehrquellen-Preisindizes), Umgang mit Forks/Airdrops und Ereignisberichten.
- Europäische Einbettung: Vereinbarkeit mit EU-Rechtsrahmen, Rollenabgrenzung zur EZB/Eurosystem-Reserven und fiskalischen Regeln (Schuldenbremse, ESA-Statistik).
Verwahrung, Bilanzierung und Risikosteuerung
Sollte eine Reserve beschlossen werden, rücken technische und risikoseitige Details in den Vordergrund. In der Verwahrung gelten segregierte Wallet-Strukturen, Mehrparteien-Signaturen, geografisch verteilte Schlüssel-Shards sowie versicherte Aufbewahrung als Mindeststandard.
Für den Betrieb sind Wiederherstellungsprozesse (Key Recovery), Zugriffstrennung (Four-Eyes-Prinzip) und ein belastbarer Incident-Response-Plan zu definieren.
Die Bewertung benötigt ein konsistentes Schema: tägliche Marktbewertung anhand unabhängiger Preisfeeds, Fixing-Zeitpunkte, Dokumentation von Bewertungsabweichungen und Offenlegung der Quellindizes.
Im Risikomanagement sind VaR- und Stresstest-Rahmen (Preis-, Liquiditäts-, Gegenparteirisiken), Limits je Handels-Desk, Szenarien zu Netzwerk- und Börsenstörungen sowie Verbote für Verleih/Derivateeinsatz zwecks Wahrung des Reservecharakters zu prüfen.
Kommunikativ ist zwischen Strategie (langfristig, regelgebunden, keine Preisziele) und Taktik (keine Marktsteuerung, keine intraday-Signale) klar zu trennen. Ein schrittweiser Aufbau reduziert Wahrnehmungs- und Marktverwerfungsrisiken; OTC-Kanäle mit dokumentierter Best-Execution begrenzen Slippage.
Gleichzeitig wirft staatlicher Erwerb Transparenzfragen auf (Wallet-Kennzeichnung, Datensouveränität) und verlangt sorgfältige Abwägungen zwischen Sicherheit und operativer Diskretion.
Makroökonomisch könnte eine Reservepolitik die Diversifikation staatlicher Rücklagen erweitern, ohne traditionelle Assets zu ersetzen. Für den Finanzmarkt hängt die Wirkung von der Größenordnung, der Planbarkeit der Zukäufe und der Qualität der Offenlegung ab.
Europarechtlich stellt sich die Koordinationsfrage: Sollte Deutschland vorangehen, wären Mindeststandards für Verwahrung, Bewertung und Reporting auf EU-Ebene sinnvoll, um Vergleichbarkeit und Finanzstabilität zu sichern.