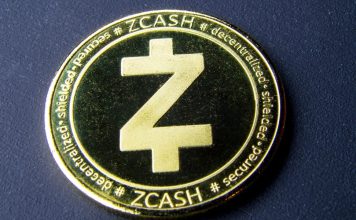- 67 % der befragten Institutionen erwarten in den nächsten drei bis sechs Monaten steigende Bitcoin-Kurse, trotz zyklischer Unsicherheiten.
- 45 % der Institutionen verorten den Zyklus bereits in einer späten Bullenphase, während nur 27 % der Nicht-Institutionen diese Sicht teilen.
Die Stimmung unter professionellen Anlegern hellt sich auf. In einer aktuellen Erhebung von Coinbase Institutional unter 124 Teilnehmern bewerten 67 % der Institutionen die Bitcoin-Perspektive für die nächsten drei bis sechs Monate positiv. Das Ergebnis fällt in eine Phase, in der die Volatilität hoch bleibt, zugleich aber makroökonomische Variablen – Zinspfad, ETF-Zuflüsse, Liquidität am Geldmarkt – besser planbar erscheinen. Bemerkenswert ist die Wahrnehmung des Zyklus: 45 % der Institutionen sehen den Markt bereits im späten Bullenstadium, gegenüber 27 % der Nicht-Institutionen. Die Divergenz deutet auf unterschiedliche Risikohorizonte und Allokationsdisziplin hin.
Stimmungsbild und Zyklusdeutung im Detail
Die Mehrheit der institutionellen Befragten erwartet kurzfristig freundlichere Notierungen, bleibt aber gespalten über die Zyklusreife. Während ein Lager auf Anschlussgewinne durch anhaltende ETF-Zuflüsse und eine stabilisierende Makrolage setzt, betont das andere Lager Bewertungsniveaus und erhöhte Sensitivität gegenüber geldpolitischen Überraschungen.
Institutionelle Anleger weisen traditionell kürzere Eskalationspfade in der Risikosteuerung auf: sprunghaft steigende Funding-Sätze, ein kräftig negativer Perps-Basis-Spread oder anziehende Spreads in Kassa-Orderbüchern werden schneller als Signal für Positionsanpassungen interpretiert.
Bei der Frage nach Trägern der Nachfrage rücken drei Faktoren in den Vordergrund: erstens der institutionelle Sockel über börsengehandelte Vehikel, zweitens Treasury-Allokationen einzelner Unternehmen und drittens Derivate-Taktik, die Spot-Zuflüsse verstetigen oder konterkarieren kann.
Für das kurzfristige Sentiment gilt: Zieht das Open Interest schneller an als die Spot-Liquidität, steigt die Wahrscheinlichkeit für elastische Bewegungen. Dagegen wirken beobachtbare ETF-Nettozuflüsse und strukturierte OTC-Abnahmen, die Orderbuchtiefe schonen.
Allokationspläne, Risikopuffer und operative Taktiken
Aus den Antworten lassen sich typische Handlungspläne ablesen. Viele Häuser halten an Kern-Exposures fest und steuern den Betateil über Futures oder Optionen. Strukturell wird vermehrt auf gestaffelte Limit-Orders, konservative Slippage-Grenzen und definierte Stopp-Fenster gesetzt, um Ausführungsrisiken in illiquiden Zeitscheiben zu begrenzen. Für Multi-Asset-Mandate bleibt die Korrelation zu Tech-Aktien und Risiko-Premiums ein zentraler Input: Fällt die Korrelation, steigt die Bereitschaft, Kryptoquoten taktisch zu erhöhen.
Risikoseitig dominieren drei Blöcke. Erstens Regulierung: Prozesse rund um Stablecoin-Regimes und Verwahrstandards bestimmen, ob Bilanz- und Treuhandmandate Krypto-Assets breiter zulassen. Zweitens Liquidität: Orderbuchtiefe, Spreads und Indexpflege (Best-Execution-Dokumentation, multiple Preisfeeds mit Ausreißerfiltern) definieren die operative Eintrittsschwelle. Drittens Gegenpartei- und Custody-Risiko: geteilte Schlüsselverwaltung, Versicherungsrahmen und ein belastbarer Incident-Response-Plan bleiben Bedingung, gerade bei Derivate-Overlays.
Anwendungsnah heißt das: Strategische Quoten werden selten aufgegeben, taktische Quoten folgen klaren Signalen. Zu den Favoriten zählen Kalendereffekte (Quartalsrollen), Funding-Divergenzen und beobachtbare ETF-Zuflüsse. Auf Produktseite wächst das Interesse an regelbasierten Vehikeln mit transparenter Methodik, geringer Tracking-Differenz und robustem Primärmarkt-Mechanismus. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach qualifizierten Collateral-Sets für Repo-nahe Strukturen und nach Instrumenten, die Cash-Management und Beta-Steuerung verbinden, ohne zusätzliche Kontrahentenrisiken zu laden.
Für die kommenden Monate rechnen die befragten Institutionen mit einer fortgesetzten Professionalisierung der Marktinfrastruktur. Ob sich der bullishe Grundton materialisiert, hängt aus Sicht der Risikochefs vor allem davon ab, ob ETF-Zuflüsse, Spot-Liquidität und Derivate-Hebel in ein tragfähiges Gleichgewicht finden – und ob geldpolitische Überraschungen ausbleiben.